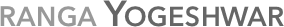Die Überforderung des Rezipienten

In einem Gespräch mit Holger Hettwer und Franco Zotta denke ich über die Grenzen der Wissensvermittlung nach.
DIE ÜBERFORDERUNG DES REZIPIENTEN
– Interview mit Ranga Yogeshwar am 15. November 2006 –
Frage: Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die nahe legen, dass das Fernsehen bei Zuschauern nur die Illusion von Wissen erzeugt – sie glauben, etwas verstanden zu haben, können aber bei genauerer Überprüfung das Gesehene oft nicht angemessen wiedergeben. Inwieweit betrachten Sie das Fernsehen als ein Medium, dass Wissen in einem gehaltvollen Sinn vermitteln kann? Ist es ein bildendes, aufklärerisches Medium?
Ranga Yogeshwar: Fernsehen ist ein extrem junges, sich rasant veränderndes Medium, das entwicklungsgeschichtlich noch nicht einmal die Pubertät erreicht hat. Wir vergessen das zuweilen, aber es ist nicht lang her, da ging das Fernsehen am frühen Abend auf Sendung und um Mitternacht ins Bett. Die meisten Zuschauer sind in einer Zeit groß geworden, in der es nur drei Fernsehprogramme gab, in der die visuelle Reizung durch Werbung ebenso unbekannt war wie die Fernbedienung und das Privatfernsehen. Damals gab es Schulfernsehen auf der Basis eines erklärten Bildungsauftrages. Die extremen Veränderungen des Mediums halten weiter an und unsere Beziehung zum Fernsehen ist dabei, sich dramatisch zu ändern. Ein Vergleich mit dem Telefon kann das verdeutlichen: Das Telefon war ursprünglich ein Informationsmedium. Der Apparat stand in normalen Wohnungen im kühlen Flur und Telefonzellen hatten sogar die Aufschrift: „Fasse Dich kurz“. Wenn man sich anschaut, wie Telefone heutzutage genutzt werden, dann würde kein Marketingmensch einer Telekommunikationsgesellschaft noch sagen: „Fasse Dich kurz“. Durch Flatrates ist die Kommunikation dauerhaft geworden, das Telefon ist auf dem Weg vom puren Informations- zum umfassenden Unterhaltungsmedium. Entsprechend ist auch die Beziehung von uns Menschen zum Telefon eine andere geworden. Parallel dazu entwickelt sich auch das Fernsehen. War der Fernseher damals, nach Einzug der Zentralheizung, der Ersatz für den brennenden Kamin und Treffpunkt der Familie, stehen heute in vielen Haushalten mehrere TV-Geräte, um unterschiedlichste Sehgewohnheiten und Bedürfnisse individuell befriedigen zu können, mit entsprechenden Folgen für das community feeling. Fernsehen geht heute auch nicht mehr zu Bett. Stattdessen kann man morgens um drei Kochsendungen sehen, obwohl einem nicht danach zu Mute ist, und selbst Shoppingkanäle, die rund um die Uhr nur Werbung senden, haben ein Publikum. Und irgendwo dazwischen gibt es auch jene, die das Fernsehen als Medium zur Wissensvermehrung nutzen.
Z: Wie wirken sich die beschriebenen technischen Veränderungen und neuen Nutzungsbedürfnisse auf das Fernsehen als wissensvermittelndes, Bildung ermöglichendes Medium aus?
Y: Technik hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Rezeptionskultur. Der ehemalige Intendant des WDR, Friedrich Nowotny, sagte mir mal ganz stolz: „Ich habe früher mal eine Wirtschaftssendung gemacht, die hatte 50 Prozent Marktanteil.“ In der damaligen Zeit gab es keine Alternativen. Man konnte eine Fernsehsendung wie einen Vortrag konzipieren und sicher sein, dass die meisten Leute sitzen bleiben. Es war möglich, eine lange Exposition zu gestalten. Man konnte dem Zuschauer zumuten, auch einmal die Durststrecke einer ausführlichen Erklärung oder eines Erkenntnisprozesses mitzugehen bevor er den nächsten sinnlichen Stimulus bekam. In der heutigen Zeit wird die Klebrigkeit des Mediums immer kürzer, was auch die Rezeptionsforschung belegt. Wenn es nicht gelingt, den Zuschauer in sehr kurzer Zeit durch einen Stimulus zu halten, wird er einfach wegschalten und auf Grund der Tatsache, dass es viel mehr Sender und alternative Medienangebote gibt, verliert man den Zuschauer rascher, als man ihn zurück gewinnt. Das führt dazu, dass wir uns als Fernsehmacher vor sehr widersprüchliche Aufgaben gestellt sehen. Auf der einen Seite verlangt erfolgreiche Wissensvermittlung, dass man sich langfristig auf etwas einlassen muss, dass man bereit ist, auch mal durch das trockene Tal des Verstehens zu wandern bis man zu einer neuen Einsicht gelangt. Dem widerspricht aber das Medium. Denn in dem Moment, wo der Zuschauer durch dieses Tal gehen soll, will er uns nicht mehr begleiten.
Ich möchte dies an einem kleinen Gedankenexperiment verdeutlichen. Stellen wir uns eine Schule vor, in der die Schüler eine Fernbedienung haben, mit der sie bei Nichtgefallen den Lehrer abschalten können. Eine solche Schule würde nicht sehr lange funktionieren. Eine analoge Situation erleben wir heute beim Fernsehen: Die mittlere Sehdauer verkürzt sich. Wir stellen fest, dass ein Großteil der Zuschauer eine Sendung nicht mehr vollständig anschaut. Viele Fernsehmacher sind deshalb dankbar, wenn überhaupt noch 20 Minuten einer 40-minütigen Sendung rezipiert werden. Das führt dazu, dass Wissensvermittlung, die auf aufeinander aufbauenden Prozessen basiert, bei denen ich also zunächst eine Grundlage schaffen muss, von der aus ich dann sukzessive fortschreite, angesichts einer solchen Sehgewohnheit kaum eine Chance hat. Man kann sagen, das Mediennutzungsverhalten bedingt eine stimulusreiche, aber eben keine erkenntniszentrierte Erzählweise. Das führt zu dem eingangs von Ihnen erwähnten Effekt: Die Zuschauer glauben zu verstehen, aber sie verstehen oft nicht.
Z: Eine paradoxe These: Das Fernsehen könnte im Sinne eines aufklärerischen Anspruchs eigentlich ein hervorragendes Massenmedium sein, aber würde es gemäß den Erfordernissen von Bildungsprozessen gestaltet, wäre es ein Medium, wo keiner zuguckt.
Y: Es ist so widersprüchlich, dass im Falle einer Wissenssendung wahrscheinlich die beste Ausnutzung darin besteht, dass viele Lehrer diese Sendung im Unterricht nutzen. Plötzlich haben wir nicht mehr die Situation der allabendlichen Couch, in der ich sehr schnell umschalte, sondern die Schüler werden geradezu gezwungen, eine Sequenz von A bis Z zu schauen und plötzlich stellt sich bei ihnen das Gefühl ein, den einen oder anderen Prozess tatsächlich verstanden zu haben. Der zweite Punkt ist, dass dieses Medium immer noch im Begriff ist, sich im Kontext der anderen Medien zu etablieren und dabei eine bestimmte Rolle zu übernehmen. Fernsehen konkurriert hinsichtlich des Zeitbudgets mit anderen Beschäftigungen wie beispielsweise Lesen oder Radio hören. Dabei schält sich zunehmend heraus, dass die eigentliche Stärke des Fernsehens die Unterhaltung ist. Mit Fernsehen vertreiben wir uns die Zeit. Wir finden also ein setting vor, bei dem viele Menschen den Fernseher nicht einschalten, weil sie etwas von der Welt verstehen wollen, sondern das Motiv des Einschaltens ist zu relaxen. Durch die immer stärker werdende Fragmentierung des Mediums, durch die wachsende Zahl der Kanäle sowie den stärker werdenden Druck, mit alternativen Medien und Freizeitangeboten zu konkurrieren, dem auch gerade Wissensformate ausgesetzt sind, werden wir immer mehr zu Vortragenden auf einer lauten Kirmes. Wissensformate konkurrieren in ihrem Unterhaltungswert mit dem leidenschaftlichen Fußballspiel oder dem Krimi im Nachbarkanal. Auf einer Kirmes, wo Schießbuden- und Tombolastände nebenan stehen, eine gute Vorlesung zu halten, ist äußerst schwer.
Hinzu kommt, dass das Medium Fernsehen eine passive Struktur aufweist, ja es ist viel passiver als jedes andere Medium, weil es nicht einmal Phantasie fordert. Wenn ich ein Buch lese ist es trivial: Ich habe nur Buchstaben, alles andere ist Phantasie, entsteht in meinem Kopf. Beim Fernsehen hingegen bekomme ich alles fertig präsentiert und das in einer, zum Teil durch die Gesetze der Werbung angetriebenen, Dynamik, so dass ich am Ende des Tages, vor dem Fernsehgerät sitzend, meine Gehirnaktivität relaxend geradezu nach unten fahre. Ein erfolgreicher Rezeptionsprozess im Kontext von Wissen und Wissen verstehen setzt aber voraus, dass die Gehirnaktivität nach oben geht. Ich nutze nun ein Medium, bei dem genau das Gegenteil der Fall ist. Das Medium selbst unterminiert also gewissermaßen meine Absicht, Wissen zu vermitteln.
Z: Das Fernsehen kommt, wie Sie eingangs erwähnt haben, entwicklungsgeschichtlich langsam zu sich selbst. Es blickt in den Spiegel und stellt erstaunt fest: „Ich bin ein Unterhaltungsmedium und kaum mehr als das“. Wenn diese Selbsterkenntnis stimmt, ist es dann nicht unsinnig, im TV einen Inhalt anders als mit den Mitteln der Unterhaltung aufzubereiten, um Massen zu erreichen? Im Fernsehen ambitionierte Wissenschaftssendungen zu machen ist dann womöglich ehrenwert, aber verlorene Liebesmüh.
Y: Das hängt davon ab, ob man den Transformationsprozess dieses Mediums mit dieser Selbsterkenntnis im Wesentlichen für abgeschlossen hält, was ich nicht glaube. Wenn ich die Entwicklung des Fernsehens im Detail betrachte, dann stehen wir noch nicht am Ende, sondern befinden uns mitten drin. In seinen Anfängen war das Wissenschaftsfernsehen tatsächlich kaum mehr als die Visualisierung eines Vortrags, weil das junge Medium noch keine Erfahrung mit sich selbst hatte und sich deshalb dramaturgisch am Ideal des universitären Vortrags orientiert hat. Heute weist das Medium eine Eigendynamik auf, die einer so gearteten Wissensvermittlung gerade abträglich ist. Ich bin überzeugt, dass wir in zehn Jahren ein tief greifendes Rearrangement der Medienlandschaft vorfinden werden: Das Internet wird sehr viel intensiver als Distributionsweg genutzt werden und wir werden im Grunde genommen nur noch wenige kollektive Großprozesse erleben, die wir dann gemeinsam irgendwo teilen: die Fußball-WM oder „Wetten, dass…?“.
Abseits solcher Kollektivereignisse müssen wir uns allerdings fragen, inwieweit das Fernsehen Gefahr läuft, sich als eigenständiges Medium dadurch zu zerstören, dass es die stetige Ausdifferenzierung seiner Angebote so weit treibt, das kein Kern mehr zu erkennen ist. In dem Moment aber, wo ich nicht nur mehr die Auswahl zwischen 30 oder 300 Sendern habe, die synchron laufen, sondern wo ich durch das Internet zusätzlich on demand unabhängig von der Zeitebene auswählen kann, eröffnen sich zugleich auch spannende Möglichkeiten für das Fernsehen der Zukunft. Denn ein wichtiges Motiv auf Seiten der Zuschauer wäre dann, etwas Spezielles wissen zu wollen und man würde jederzeit gezielt eine Sendung aufrufen können, die meinen Ansprüchen genügt. Im Moment ist das Fernsehen immer noch ein Wundertütenpaket. Wenn ich Glück habe, läuft gerade irgendeine Dokumentation, wenn ich Dokumentationen anschauen möchte, aber das ist nicht immer der Fall. Unter Umständen wird die Differenzierung des Mediums über den digitalen Weg dazu führen, dass eine Nische innerhalb dieser bildbasierten Medien entsteht, die vielleicht sogar besser zur Wissensvermittlung geeignet ist als das Fernsehen, was wir heute kennen. Aber werden diese Spartenkanäle noch finanzierbar sein? Wird man noch in der Lage sein, mit denselben opulenten Bildern und Prozessen zu hantieren wie heute?
Z: Wissenschaftsfernsehen ist Minderheitenfernsehen?
Y: Wenn man nach Pompeji geht, dann sieht man ein schönes Theater, in dem etwa 300 Personen Platz fanden. Etwa 700 Meter davon entfernt gibt es ein mächtiges Amphitheater, in dem Blut floss. Dort fanden vor bis zu 20.000 Zuschauern die spektakulären Kämpfe der Gladiatoren statt. Wir sollten uns also nicht mehr der Illusion hingeben zu meinen, es sei früher anders gewesen – Wissensvermittlung war immer etwas für Minderheiten. Der Hauptattraktor war früher wie heute das Blut. Der Unterschied ist nur, dass das Fernsehen sehr viel Geld kostet und nur dann überleben kann, wenn die Masse auch zuschaltet, im Gegensatz zum vergleichsweise preiswerten Printmedium. Die Fachsendung wird unter Umständen verlieren, weil sie in der Genese zu teuer ist und im Vergleich zum Rest zu wenige Zuschauer findet. Das Theater in Pompeji hätte schließen müssen, wenn es nur noch 20 Zuschauer angezogen hätte; das ist ein bisschen die Situation, die wir heute haben.
Welche Auswirkungen hat das Phänomen des Zappings auf den Erfolg von Wissensvermittlung im Fernsehen?
Y: Das Zapping ist unter informationstheoretischen Gesichtspunkten ein überaus spannender Prozess: Junge Menschen sind in der Lage zeitgleich Informationsflüsse zu verfolgen, die auf verschiedenen Kanälen ablaufen. Sie schauen so gleichzeitig nicht eine, sondern drei Sendungen. Der Linearität des Mediums gemäß findet Wissensvermittlung im Fernsehen durch ein sukzessives Fortschreiten von einem Erklärungsstück zum nächsten statt. Die Zapping-Kultur clustert hingegen Wissen; ich habe dann kein linear strukturiertes Wissen mehr. Das kann zur Folge haben, dass wir die Wissensvermittlung dem Rezeptionsverhalten junger Menschen anpassen müssen, dass wir sie so aufbauen müssen, wie junge Menschen sich heute zum Beispiel mit technischen Geräten auseinandersetzen. Obwohl junge Leute heute eine Betriebsanleitung nicht mehr von A bis Z lesen, sondern probieren und ein trial and error-Spiel daraus machen, wissen sie am Ende, wie es geht. Ich sehe das nicht als Götterdämmerung, sondern als einen Wandel in der Art unseres Zugriffs auf Informationen. Ob es dem Fernsehen gelingen wird, auf die – auch durch das Internet induzierten – neuen Rezeptionsgewohnheiten adäquat zu reagieren und wie Wissen zukünftig so verpackt werden kann, dass sich in der Konkurrenz vieler Häppchen ein Gesamtbild ergibt, wird sich zeigen. Die alte Linearität des Wissens wird sich jedoch auflösen.
Würde dann eine einheitliche Dramaturgie obsolet werden?
Y: Es gibt Mikro- und Makro-Dramaturgien. Wenn man heutzutage mit jungen Menschen spricht und ihnen ein Stück von Orson Welles zeigt, dann stellt man fest, dass sie absolut nicht mehr bereit sind, sich mit der Langatmigkeit dieser Dramaturgie zu synchronisieren. Heute läuft das anders ab, aber ich glaube dennoch, dass es eine Dramaturgie gibt, die über lange Strecken führt, auch wenn sie anders gestaltet werden muss als zu Welles’ Zeiten. Das ist wie bei einem Fußballspiel: Es dauert seine zwei Mal 45 Minuten, aber im Kern ist es aus einem Mosaik kleiner dramaturgischer Einzelerlebnisse zusammengesetzt. Die Frage ist, schafft man es – so wie bei einem Fußballspiel – aus diesen kleinen Erlebnissen, die mitunter auch noch mal genauer reflektiert oder in Zeitlupe kommentiert werden, trotzdem ein Gesamtbild zu schaffen. Unter Umständen funktioniert das. Das könnte zur Folge haben, dass wir ein Häppchenfernsehen haben, was, statt dass wir eine Sendung 45 Minuten am Stück sehen, uns Teilbereiche daraus zeigt und diese Teilbereiche in dem Mosaik am Ende dieselbe Wirkung haben wie eine 45-Minuten-am-Stück-Sendung.
Z: Ließe sich das, was Sie da so visionär beschreiben, unter dem Begriff Collage fassen?
Y: Es ist Collage, aber diese Darstellungsweise wird wohl auch dadurch evoziert, dass unsere Wahrnehmung von Welt in gewisser Weise selbst den Charakter einer Collage annimmt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es kaum optische Impulse, die Städte waren ziemlich farblos und Information hatte einen besonderen Wert und wurde komplett rezipiert. Heute werden die Städte von Werbetafeln, Reklamen und visuellen Eindrücken überschwemmt, so dass die Rezeptionskultur eher dahin führt, sich aus der überbordenden Vielfalt sein eigenes Bild zusammenzufügen. Das kann sich auch auf Wissenssendungen beziehen. Unter Umständen weiß ein Zuschauer nicht mehr eindeutig zuzuordnen, woher er sein Wissen hat, sondern es ist ein Mix mit unbekannter Herkunft. So ähnlich wie der junge Mensch, der heute eben nicht mehr die Betriebsanleitung lernt; am Ende kann er den Computer oder das Mobiltelefon bedienen, woher dieses praktische Wissen stammt, kann er jedoch nicht mehr eruieren.
Z: Der Medientheoretiker Walter Benjamin war der Meinung, man könne das 19. Jahrhundert nur begreifen, wenn man wie in einer Collage aus allen Teilbereichen der Gesellschaft, von der Wirtschaft bis zur Kunst, Zitate sammelt und so in der Gesamtschau all dieser Zitate das 19. Jahrhundert nachträglich erneut erzeugt. Die Idee dahinter war aber, dass wir noch eine Vorstellung vom Ganzen haben, das noch so etwas wie eine konsistente Theorie des Jahrhunderts denkbar ist. Sie beschreiben nun eine Collage, der dieses verbindende Moment weitgehend fehlt: Der Zuschauer sammelt Informationsbausteine, möglicherweise entsteht daraus sogar Wissen, aber es bleibt ein Wissen ohne Kontext. Ich kann Geräte bedienen, aber ich verstehe sie nicht mehr. Und ich muss sie auch nicht verstehen, denn im Grunde geht es nicht um Wissen in Kontextbezügen, sondern um funktionales Wissen in dem Sinne, dass ich mich damit zwar in meiner Welt behaupten kann, den Grundlagen dieser Welt aber zunehmend ratlos gegenüber stehe.
Y: Erinnere ich mich an das Auto meiner Studentenzeit, dann gab es noch eine Kultur des Schraubens, eine Kultur des Selber-Reparierens, eine Kultur des Vergaser-Einstellens. Heutige Autos zeigen eine glatte Oberfläche und, wenn man Glück hat, irgendwo ein Plug-In für einen Diagnostik-Computer. Die Erwartungshaltung, ein technisches Gerät so zu verstehen, dass wir es selbst reparieren können, haben wir heute nicht mehr. Heißt das, dass heutige junge Menschen schlechtere Autofahrer sind? Nein. Heißt das, dass junge Menschen heute weniger über Technik wüssten? Nein. Die Art der Anwendung von Technik ist hingegen eine völlig andere geworden. Junge Menschen überlegen sehr wohl, was man mit Computern machen kann oder wohin Entwicklungen führen. Wir erleben ja keinen Erkenntnisstillstand, sondern beobachten im Gegenteil eine enorme Dynamik. Es hat sich zunächst nur die alte Kategorie des direkten Reproduzierens von Wissen aufgelöst, was sich auch an Wissenssendungen zeigt. Die ersten Wissenssendungen, die ich bei Berufsanfang gesehen habe, waren bessere Kochrezepturen für wissenschaftlich-technische Assistenten. In den Beiträgen wurde genau erklärt, wie viele Minuten die DNA bei welcher Temperatur wie zentrifugiert werden muss, um zu einem gewünschten Ergebnis zu gelangen. Mittlerweile haben wir verstanden, dass wir das nicht mehr brauchen, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass wir schlechter verstehen. Wir haben vielmehr die Ebenen gewechselt und wandern heute eher auf zwei Verstehensebenen: auf der basalen Ebene suchen wir nach wie vor zu begreifen, was die fundamentalen Prinzipien sind, nach denen die Welt funktioniert. Das ist die elitäre Welt der Experten. Auf der praktischen Ebene spielt hingegen die sinnvolle Anwendbarkeit des Wissens aus der Perspektive des Rezipienten eine viel größere Rolle. Das technische Wissen ist in einer Welt, die zunehmend komplexer wird, nicht mehr das, was im Vordergrund steht, weil für den Einzelnen eine universelle technische Kompetenz absolut unerreichbar geworden ist. Dass ich mich auf der work bench in der Biochemie vielleicht auskennen kann, aber spätestens beim Gang in das nächste Labor bei der Konfigurierung eines Computer-Netzwerks scheitere, führt dazu, dass wir einen Rückzug aus der Spezialisierung hin in eine andere Welt haben. Wissen bedeutet heute eben nicht mehr jenes reproduzierbare, eng an die Wissenschaft gekoppelte Wissen, sondern mutiert zunehmend zu einem Mosaik an Impressionen, die ein Bild ergeben. Aber dieses Bild beantwortet nicht die Frage und kann sie nicht mehr beantworten, wie tue ich das oder wie kommt man dahin, sondern ist viel stärker von emotionalen Faktoren genährt, von Gesamteinschätzungen, von Clustern, die oft nicht mehr in ihrer Schichtigkeit benannt werden, die aber trotzdem zu einer Meinungsbildung bzw. zu einem Wissen in Anführungszeichen führen.
Die erfolgreichsten Sendungen sind aber trotzdem diejenigen, die fragen‚ wie die Wurst in die Pelle kommt.
Y: Das ist eine Spezialkategorie. Diese Spezialkategorie bezeichne ich als Klarheit in der komplexen Welt. Solche Sendungen wollen dem Zuschauer zumindest das Gefühl vermitteln, die Welt besser zu verstehen. Sie reagieren auf das Bedürfnis nach Orientierung in einer Welt, in der ich z. B. nicht mehr weiß, was ich esse oder woher meine Lebensmittel stammen. Wenn wir aber ehrlich sind, ist es gar nicht unser Ziel, wirklich die Welt besser zu verstehen, sondern die meisten Menschen wollen einfach besser in dieser Welt zu Recht kommen. Muss ich verstehen, wie die Wurst in die Pelle kommt, damit ich die Wurst kaufe oder damit sie mir schmeckt? Vielleicht ist ein ganz anderes Wissen wichtiger. Ich glaube auch, dass die meisten Ärzte nicht wissen, wie die Injektionsnadeln in die Verpackungen kommen. Sind sie deshalb schlechtere Ärzte? Ihre Fragestellung ist einfach eine andere und ich glaube, so ähnlich verhält es sich auch bei uns Zuschauern oder Bürgern. Es ist der Job von Spezialisten, Würste in die Pelle zu setzen oder Motoren unter die Haube zu bauen; we take it for granted, wir müssen es nicht mehr nachstellen. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso die Leute 90 Minuten ein Fußballspiel sehen.
Y: Das Spannende beim Fußballspiel ist nicht nur, warum die Leute 90 Minuten ein Fußballspiel verfolgen, sondern auch, warum sie die 2½ Stunden vorher und nachher vor dem Fernseher sitzen bleiben. Ich glaube, es ist eine tiefe gesellschaftliche Sehnsucht einer fragmentierten Gesellschaft, manchmal Cluster der Gemeinschaftlichkeit zu erleben. Im WM-Sommer sahen wir das sehr schön an den public viewing-Events zur Fußball-Weltmeisterschaft, die einen enormen Zulauf hatten; die Menschen versammelten sich trotz miserabler Bild- und Tonqualität auf großen Plätzen vor Leinwänden, um die Spiele kollektiv zu erleben. Es gab einfach ein Fluidum von Gemeinsamkeit, das durch diese Menschen ging und ich glaube, das sind Gegenreaktionen zu der Segmentierung durch das Internet. Je mehr unser Alltag segmentiert, desto stärker wird das Bedürfnis nach gemeinsamen Kollektivereignissen. Im Zeitalter des differenzierten Bürgers werden zunehmend willkürlich gesetzte Ereignisse kollektiv zelebriert. Das hat nichts mehr mit Rezeption im engeren Sinne zu tun, sondern ist Ausdruck eines gesellschaftlichen Bedürfnisses.
Können auch Wissenschaftsthemen zum Anlasse kollektiver Aufmerksamkeit werden?
Y: Das gilt interessanterweise auch für Wissenschaftsthemen; von Zeit zu Zeit ist es machbar. Die erste Mondlandung wäre ein prägnantes Beispiel. – Wenn wir ein bisschen warten, können wir im Januar 2007 vielleicht gemeinsam den Kometen P1 Mac beobachten, der wahrscheinlich auf eine Distanz von schätzungsweise 0,14 astronomischen Einheiten zur Erde gehen wird. Wenn wir Glück haben, werden wir bei Sonnenaufgängen oder Sonnenuntergängen einen brillanten Streifen und Schweif sehen. In solchen Momenten kann auch Wissenschaft gleichsam zum Katalysator eines Gemeinschaftsgefühls werden. Die Sonnenfinsternis wäre ein anderes schönes Beispiel dafür. Da funktioniert das. Aber es liegt nicht in der Natur der Wissenschaft, es zu tun.
.
Das Interview führten Holger Hettwer und Franco Zotta. Der Text stammt aus dem Buch: “WissensWelten – Wissenschaftsjournalismus in Theorie und Praxis”
( März 2008 )