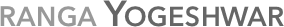Integration…

….manche scheinen zu glauben, Integration heiße, einem Kenianer so lange Deutsch beizubringen, bis er blond und weißhäutig ist…..
Der Artikel wurde u.a. beim Deutschen Olympischen Sportbund veröffentlicht.
„UNSER GRENZVERSTÄNDNIS ERINNERT AN GORETEX“
Er ist in Luxemburg geboren, in Indien aufgewachsen und lebt seit über 30 Jahren in Deutschland: Der TV-Journalist und Physiker Ranga Yogeshwar hat das Weltenwandern und Brückenbauen verinnerlicht. Ein Gespräch über Verlustängste, Komfortzonen und die „Deutsche Kultur“.
Gespräch: Marcus Meyer und Nicolas Richter
Herr Yogeshwar, Sie sind mal mit dem Satz zitiert worden: „Ich bin Wissenschaftler, Macher und Lebenskünstler.“ Worin besteht Ihre Lebenskunst?
Das jedem von uns geschenkte Leben in seiner Einzigartigkeit möglichst reich auszufüllen: offen zu sein gegenüber dem, was uns umgibt, im Kleinen wie im Großen, sich immer wieder zu trauen, andere Wege einzuschlagen. Routine ist für mich der Tod. Das Wunderbare am Leben ist doch, dass man ständig überrascht wird.
Sie sind Grenzgänger, biografisch wie beruflich, und mit der Sternwarte in Ihrem Garten blicken Sie ins All. Möchten Sie grenzenlos leben?
Grenzenlos vielleicht nicht, das wäre ein Widerspruch in sich; das Leben ist ja begrenzt. Aber vielleicht resultiert gerade aus diesem Umstand mein Anspruch, die Lebenszeit nicht unachtsam verstreichen zu lassen.
Sind manche Grenzen nicht auch hilfreich bis notwendig?
Man muss unterscheiden. Grenzen können Schutz bieten, das Bedürfnis danach ist etwas Natürliches. Denken Sie an die menschliche Gestik: Wenn Sie Angst haben, schaffen Sie eine Grenze, decken die Arme übereinander, legen sie vor die Brust, minimieren Ihre Körperoberfläche. Aber als Arbeitnehmer zum Beispiel erleben wir die Grenzen von Systemen, von betrieblichen Institutionen: Darf ich das, darf ich das nicht? Menschen werden von anderen in die eine oder die andere Richtung gelotst. Das führt auf Dauer zu einem nicht selbstbestimmten Leben. Auch durch Tradition oder viele Organisationen oder durch Trägheit gesetzte Grenzen sollte man sich trauen zu überschreiten. Nicht umsonst spricht man vom Über-den-Tellerrand-Schauen. Natürlich verunsichert es, bekanntes Gebiet zu verlassen, aber dadurch können Sie die Fläche Ihrer Lebenserfahrung erweitern.
Sie sind daran gewöhnt: Ihre Lebensorte haben in der Jugend mehrmals zwischen Indien und Europa gewechselt.
Wenn man so lebt, spürt man sehr deutlich, dass es Alternativen zu dem Sein einer Kultur, einer Gesellschaft gibt. Ich habe gelernt, dass es nicht die eine Kultur gibt, die für alles steht, man hat immer Alternativen. Eine Art Plan B fürs Leben.
Kann man Neugier und Unverzagtheit überhaupt lernen, oder ist das eine Frage der Persönlichkeit?
Natürlich sind viele durch ihr Elternhaus von einer gewissen Ängstlichkeit geprägt. Wer sich aber in jungen Jahren Grenzen sucht und sich bewusst über manche hinauswagt, kann diese Ängstlichkeit ablegen. Ich habe sehr davon profitiert, dass ich nach meinem Studium abgehauen und ein Jahr ins indische Gebirge gegangen bin. So etwas steht nicht im Drehbuch einer gängigen Biografie. Heute gibt es viele junge Menschen, die aus Angst vor geringeren Karrierechancen in eine Art Algorithmus der Daueroptimierung kommen und es nicht merken: Sie sammeln Credit-Points, versuchen rasch eine Anstellung zu finden, sind ungeheuer konform. Was für ein Widerspruch: Wir leben in einer Zeit, in der ganz viel Neues passiert und die Furcht vor außerplanmäßigen Erfahrungen wächst.
Die Angst, der schlechte Ratgeber?
Zumindest ist sie das Motiv vieler Grenzen. Im Privaten, wo die Haustür aus Angst vor Einbrechern verschlossen wird. Oder gesellschaftlich, in der Diskussion um Flüchtlinge, wo die Angst vor dem Unbekannten dazu führt, dass man wieder Grenzzäune hochziehen will. Die deutsche Sprache kennt auch den Begriff „begrenzt sein“. Er zeigt sehr deutlich die Gegenseite dieses Verhaltens: in Angst gefangen zu sein und auf Erfahrungen, neue Menschen, neue Eindrücke zu verzichten.
Ist diese Angst speziell deutsch oder speziell europäisch?
Nein, Angst ist etwas Natürliches, wie gesagt. Aber in Deutschland bestehen offenbar Verlustängste, zu denen rational betrachtet keinerlei Anlass besteht. Wir sind eine gesättigte Nation, die sich vor dem Verlassen der Komfortzone scheut.
Sie sagen „Wir“. Können Sie das Gefühl nachvollziehen?
Natürlich. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Es ist ja nicht so, dass ich keine Angst habe, aber meine Großmutter sagte immer: Mut ist bezähmte Angst. Insofern geht es nicht darum, Angst nicht zu spüren, sondern trotzdem die Chancen zu sehen, die neue Situationen bieten. Das ist eine Haltungsfrage.
Seit Jahren wird darüber debattiert, wie weit sich Zugezogene unserer Kultur anpassen müssen. Was ist das für Sie, „Deutsche Kultur“, jenseits von Schlagworten wie Pünktlichkeit und einem gewissen Demokratieverständnis?
Wenn ich die Deutsche Bahn mit der japanischen vergleiche, dann ist Deutschland ziemlich unpünktlich. Insofern wissen wir vielleicht selbst nicht mehr, was uns im 21. Jahrhundert ausmacht. Nation und Rahmenbedingungen sind nicht mehr die gleichen wie vor 40 oder 50 Jahren.
Machen Sie einen Vorschlag: Was ist „Deutsche Kultur“?
Der britische Kunsthistoriker Neil MacGregor hat ein wunderbares Buch über Deutschland geschrieben. Darin vergleicht er unter anderem Städte wie Paris, London und München, in denen jeweils ein Triumphbogen steht. Während es in London und Paris um die großen Siege gehe, sei der in München eher Zeuge einer Niederlage. Denn die eine Seite sei während des 2. Weltkrieges zerstört worden, und man habe diese Wunden und Narben bewusst belassen, um auf die begangenen Fehler hinzuweisen. Und in Berlin steht das Holocaust-Mahnmal mitten im Zentrum! Ich kenne keine andere Nation, die sich auf so offene und intensive Weise mit der eigenen Schuld und Vergangenheit auseinandersetzt. Deshalb empfinde ich die deutsche Kultur als viel wahrhaftiger, ehrlicher als die meisten anderen. Damit einher geht mitunter leider die Angst vor zu viel Selbstbewusstsein.
Fühlen Sie sich als Deutscher?
Nein, nicht im klassischen Sinne. Ich gehöre zu einer wachsenden Zahl von Menschen mit Eltern, die aus unterschiedlichen Ländern stammen. Insofern tue ich mich schwer mit nationalstaatlichen Kategorien. Wenn manche „deutsch“ sagen, haben sie ziemlich veraltete Vorstellungen im Kopf. Und sie denken nicht daran, dass Bundesinnenminister de Maizière wahrscheinlich Hugenotten unter seinen Vorfahren hat, die aus Frankreich geflohen sind, nachdem Ludwig XIV. Ende des 17. Jahrhunderts das Edikt von Nantes aufgekündigt hatte.
Erleben diese „veralteten Vorstellungen“ eine Renaissance? Seit Jahren geistert das Stichwort „Leitkultur“ durch die Debatten: eine Kultur, der sich die Migranten anpassen müssten.
Ja, manche scheinen zu glauben, Integration heiße, einem Kenianer so lange Deutsch beizubringen, bis er blond und weißhäutig ist. Das wird naturgemäß nicht funktionieren. Wer von „Integration“ spricht, sollte wissen, wohin er will.
Wie meinen Sie das?
Wir müssen die nationalen Kategorien, die Hochnäsigkeit in Bezug auf die eigene Kultur fallen lassen. Von der Vorstellung Abstand nehmen, dass Ankommende Nachhilfe bei der „deutschen Kultur“ nehmen müssten – ohne dabei in Betracht zu ziehen, was wir von ihnen lernen können. Integration darf kein Top-down-Prozess sein. Es geht um ein gemeinsam vereinbartes Betriebssystem, eine Form der Freiheit, der Toleranz, der Regeln, alles, was im Grundgesetz festgehalten ist. Und wer sich daran hält, den akzeptiere ich auch in seiner Eigenheit. Bei Mesut Özil zum Beispiel bin ich mir nicht sicher, ob er als Deutscher wahrgenommen wird, obwohl er in der Nationalmannschaft spielt.
Woher rührt das Festhalten an „Kultur“ in diesem Sinne?
Ich glaube, die Diskussion ist Ausdruck für die Suche nach Beständigkeit in einer Welt des Wandels, der so schnell, so dramatisch vonstattengeht, dass sich große Teile der Bevölkerung überrannt fühlen. Digitalisierung und Globalisierung haben zu einer grundlegenden Verunsicherung geführt. Nehmen Sie die überall gleiche Mode, die überall laufenden Blockbuster-Filme, die zum Verwechseln ähnlichen Innenstädte, etwa von Atlanta oder Singapur. Oder die Jugendlichen, die Ohrstöpsel tragen, ob sie aus Deutschland, Frankreich oder Syrien kommen. Während sich die Kulturen angleichen, suchen die Menschen nach einem Kern, etwas Unverwechselbarem, einer Heimat.
Ist es uns zu viel geworden mit der Globalisierung?
Wir haben ein Grenzverständnis, das an Goretex erinnert. Sie kennen das: Das eine geht raus, das andere kommt nicht rein. Deutschland hat immer gern seine Produkte exportiert, wollte aber um Gottes Willen keine Menschen.
Im Moment kommt die Verlustangst hinzu. Und die vor der Entwicklung von „Parallelgesellschaften“ – noch so ein Schlagwort.
Ja, doch eigentlich erleben wir eine ganz andere Form der Parallelgesellschaft. Nämlich die der sozialen Unterschiede. Vor 30 Jahren, als ich beim Fernsehen anfing, hätte ich wahrscheinlich eine Abmahnung bekommen, wenn ich in einer Sendung von Unterschicht gesprochen hätte. Mittlerweile ist der Terminus salonfähig. Es ist eine zunehmende Abschottung zu beobachten, denken wir an Hartz IV oder an die sogenannten Gated Communities in Städten, wo Reiche von Armen durch einen Zaun getrennt werden. Dieses Denken, die Akzeptanz einer Parallelgesellschaft, die auf soziale Unterschiede zielt, hat in Deutschland in erschreckendem Maße zugenommen. Und in diesem Widerspruch liegt der Nährboden für Konflikte.
In der öffentlichen Debatte wird der Begriff „Parallelgesellschaft“ aber häufiger in einem kulturellen und weniger in einem sozialen Kontext verwendet.
Das sind letztlich verschiedene Aspekte einer historischen Fehlentwicklung: Integration oder Willkommenskultur sind neue Begriffe. Früher sprachen wir von Gastarbeitern, Motto: Arbeite, und wenn du fertig bist, kannst du gehen. Die Menschen sollten nicht hier bleiben, sie mussten kein Deutsch lernen, konnten beruflich schwer aufsteigen. Daraus entstand ihre Gettoisierung als eine Form der Ausgrenzung. Eine andere Sache ist die kulturelle Stigmatisierung. Ich habe das mit den Indern erlebt. Vor 30 Jahren waren sie das Synonym für Mutter Teresa, den „Tiger von Eschnapur“. Inder waren im Wesentlichen hungrig, unterernährt und Analphabeten. Wenn man heutzutage von Indern spricht, meint man immer IT-Experten. Da sieht man, wie sich das Bewusstsein wandeln kann.
Aber nur bedingt: Ein Klischee löst das andere ab. Was kann man tun, um kulturelle Wahrnehmung zu verfeinern?
Da komme ich wieder auf das Phänomen Parallelgesellschaft. Die Wahrnehmung fremder Kulturen speist sich oft daraus, dass man über Menschen oder über Flüchtlinge spricht, selten mit ihnen. Das ist gefährlich, weil ein großer blinder Fleck entsteht, der als Projektionsfläche für viele Ängste und Extrapolationen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, dienen muss. Ich vermute: Ein Großteil der deutschen Bevölkerung hat in den vergangenen sechs Monaten wahrscheinlich nicht einen Satz mit einem syrischen Flüchtling gewechselt. Er lebt also in einer Parallelwelt, zumindest in unserer Vorstellung.
Wie sehen Sie die Rolle des Sports?
Die Funktion ist gar nicht zu überschätzen. Das ist zum Beispiel bei uns in der Gemeinde zu beobachten. Wenn die jungen, männlichen Flüchtlinge Fußball spielen, dann merken sie gar nicht mehr, woher sie kommen. Es ist eine elementare Art, um Kulturen zusammenzubringen. Das zieht sich durch bis zu einer deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die nicht in Kategorien klassischer deutscher Vorstellungen zu fassen ist.
Und was wäre Aufgabe der Medien?
Ich erwarte mehr Reflexion. Das Fernsehen zum Beispiel macht die Bilder. Wenn wir von Asylbewerbern sprechen, dann sehen wir im TV in der Regel relativ anonyme Haufen von Menschen statt Einzelschicksale, die viel eher in unser Bewusstsein drängen und uns sensibilisieren könnten. Leider ist es oft gefangen in seiner eigenen Logik. Die Sender lieben es, Talkshows zu machen, aktuelle Themen zu hypen, aber sie reflektieren die Konsequenzen nicht. Da Fernsehen immer noch großen Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein hat, ist das natürlich problematisch.
Sehen Sie die öffentlich-rechtlichen Sender stärker in der Pflicht?
Ich fordere sie seit vielen Jahren dazu auf, ihrer besonderen gesellschaftlichen Rolle gerecht zu werden und nicht Zeit und Geld damit zu verplempern, kommerzielle Konkurrenten zu imitieren. Wir brauchen Medien dringender denn je als unabhängige Beobachter von Entwicklungen. Insofern dürfen sie nicht allein in ökonomischen Kategorien denken und zu Gehilfen der Werbe- und Marketingindustrie werden.